Digitalisierung 2023: So läuft es bei eAU und eRezept
Wie ist der Stand bei der eAU?
Dr Thomas Kriedel; Mitglied des Vorstands der KBV:
"Ein Großteil der Praxen kann damit umgehen. Es funktioniert, aber leider noch in vielen Einzelfällen, die sehr ärgerlich sind, klappt es nicht. Aber insgesamt läuft es recht gut für die Probleme, die es am Anfang gegeben hat. Was natürlich ein Problem ist, dass wir nicht genau wissen, wie es bei den Arbeitgebern aussieht. Denn der Prozess ist ja so, die Praxis schickt ja die eAU auf einen Server, wo der Arbeitgeber sie dann abrufen muss. Und unsere Sorge war, das hat sich Gott sei Dank bislang noch nicht bewahrheitet, dass dann die Arbeitgeber nicht genau wissen, ja, muss ich die dann abrufen, wie geht das. Und im Zweifel dann ihrem Arbeitnehmer wieder sagen, nee, das kenne ich nicht, holen Sie sich mal eine richtige Arbeitsunfähigkeit und dass dann die Probleme wieder in die Praxen getragen werden. Wie gesagt, wir sind jetzt Anfang des Jahres. Das hat sich Gott sei Dank noch nicht bewahrheitet und wir gehen davon aus, dass das relativ gut laufen wird, gerade wenn die letzten technischen Fehler auch endgültig ausgemerzt sind."
Wird das eRezept dann auch bald flächendeckend kommen?
Dr Thomas Kriedel; Mitglied des Vorstands der KBV: "Das eRezept ist ja unser Sorgenkind, eine riesige Flächenanwendung, die jede Praxis mehrfach dutzendfach am Tag beschäftigen wird. Insofern war es uns ganz wichtig, dass wir auch einen ausreichenden Flächentest hinbekommen haben. Und in 2 KVen, insbesondere jetzt am Ende in der KV Westfalenlippe ist es ja getestet worden, umgesetzt worden im Ausrollen, aber dabei hat sich gezeigt, dass weder die Arztpraxen noch vor allem auch die Patienten, die Versicherten, das von der Gematik angedachte Verfahren akzeptiert haben. Das heißt, die Patienten wollten keinen QR-Code auf Papier haben und damit in die Apotheke gehen. Die haben im Prinzip gesagt, ja, wenn es schon elektronisch ist, dann hätte ich doch gerne auch eine elektronische Einlösemöglichkeit. Und deshalb hat sich da herauskristallisiert, man sollte doch den elektronischen Patientenausweis nehmen, die eGK, elektronische Gesundheitskarte, nehmen. Das ist auch akzeptiert worden von der Gematik, auch vom Gesundheitsministerium. Aber da es nicht vorgedacht war, muss man erst noch die ganze Technik umbauen, weil auch der Bundesdatenschützer dort gesagt hat, Stopp, das was ihr angedacht habt ohne weitere Spezifikation, ist datenschutztechnisch unsicher und deshalb leider dauert es nach den Plänen der Gematik bis Mitte des Jahres, also vor August, Juli/August wird es wahrscheinlich nicht möglich sein, die eGK zu nutzen. Dann aber erwarten wir uns ein schnelles Ausrollen, denn wir haben in der Gematik ja festgelegt, dass 25 % der Rezepte elektronisch ausgestellt sein müssen in der Testregion. Erst dann soll der Ausrollprozess in weitere KVen gehen und das halten wir auch für sinnvoll. Bei dieser Masse ist dann sichergestellt, dass ausreichend getestet ist."
Ist das eRezept denn schon Pflicht für die Praxen?
Dr Thomas Kriedel; Mitglied des Vorstands der KBV:
"Wir haben diesen gestuften Prozess in der Gematik beschlossen, das heißt, das Umsetzen wird dann erst möglich werden, wenn diese Kriterien erfüllt sind. Das heißt ausreichende Testung, das heißt, 25 % müssen umgesetzt worden sein. Und da legen wir großen Wert drauf. Das hat auch die Praxis gezeigt, die Erfahrung, es macht keinen Sinn, vorher schon einzusteigen."
Können Praxen das eRezept aber schon anwenden, wenn sie das wünschen?
Dr Thomas Kriedel; Mitglied des Vorstands der KBV:
"Das ist so, es gibt ja dieses Verfahren, was schon umgesetzt worden ist, was auch im Gesetz so steht. Im Prinzip ist es das Verfahren, dass die Praxis einen elektronischen QR-Code produziert, diesen auch elektronisch übermittelt auf einen Server, von dem der Apotheker dann mit diesem Code das Rezept und damit die Verordnungserlaubnis abrufen kann. Das Problem ist nur aufseiten des Patienten, wenn der kein Smartphone hat, es nicht nutzen will, muss er Papier bekommen. Und das ist eben in der Praxis, hat die Erfahrung gezeigt, weder in der Arztpraxis noch vom Patienten gewünscht. Aber selbstverständlich, wenn Praxen das einsetzen wollen, und sei es nur, um es auszuprobieren und die Patienten mitmachen, dann kann er dieses Verfahren nutzen."
Wie sieht es mit der Umstellung der TI-Finanzierung aus?
Dr Thomas Kriedel; Mitglied des Vorstands der KBV:
"Ein ganz schwieriges Thema. Wir waren alle überrascht, dass der Gesetzgeber relativ kurzfristig in ein Gesetz reingeschrieben hat, dass die bisherige TI-Finanzierung umgestellt werden sollte. Bisher war es ja so, dass der Arzt, die Praxis bekam die Investitionskosten finanziert, beispielsweise ein neuer Konnektor wurde bezahlt, nach einem Schiedsamt-Verfahren hoffentlich kostendeckend, aber wurde bezahlt. Und daneben gab es auch noch immer laufende Kosten, Betriebskosten für die TI. Das war ein eingespieltes Verfahren. Jetzt hat der Gesetzgeber gesagt, nein, das Verfahren ist ungeeignet, wirklich Wettbewerb in den Markt zu bringen. Und wir versuchen es mal anders. Und das anders bedeutet: Die Arztpraxen sollen ab 1. 7. diesen Jahres eine Monatspauschale bekommen. Und diese Monatspauschale soll alle Kosten abdecken, sowohl die Investition, beispielsweise Kosten für ein Lesegerät, für einen Konnektor wie auch die laufenden Betriebskosten. Das ist natürlich ein völliger Systembruch und da sind viele Probleme mit verbunden. Ein Problem ist einfach die Umsetzung. Es gibt Praxen, die haben bereits einen neuen Konnektor, die haben die Erstausstattung bezahlt bekommen, bekommen die jetzt dieselbe Pauschale, eine verringerte. Und was mit den neuen Praxen, die noch nicht angeschlossen sind? Müssen die jetzt in Vorleistung gehen? Das heißt, wenn die Industrie nicht reagiert und sagt, nein, ich möchte aber weiter die Investitionskosten für Geräte, sagen wir mal 3000 € möchte ich aber haben. Dann hat der Arzt ein Problem, denn er bekommt ja nur monatsweise die Kosten erstattet. Es kann aber auch sein, dass die Industrie darauf reagiert, aber sagt, gut, wenn ich das mache in Monatsbeträgen von 300 € zum Beispiel, dass ich dann aber einen Vertrag mit der Arztpraxis über 2, 3, 4, 5 Jahre brauche, um die Kosten zu refinanzieren. Das alles ist für uns unklar. Wir sind in Verhandlungen. Bis zum 30.4. müssen die Verhandlungen abgeschlossen sein. Ein sehr enger Zeitraum für ein so komplexes Thema. Und wir möchten natürlich nicht, dass die Arztpraxen wieder in Vorleistung gehen müssen, noch dass sie zurückzahlen müssen. Und dazu müssen wir eine intelligente Lösung finden und das schnell."
Seit Anfang Januar 2023 ist die Umstellung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom Papier-Formular auf eine digitale Lösung einen Schritt weiter: das Arbeitgeberverfahren ist gestartet. Das heißt Arbeitgeber können nun die Informationen zur Krankschreibung ihrer Mitarbeitenden bei deren Krankenkasse abrufen. Damit entfällt ein weiterer Ausdruck. Ohne Ausdruck ist es dagegen bislang schwer beim elektronischen Rezept. Hier wird weiterhin an einer komfortablen Lösung gearbeitet. Dr. Thomas Kriedel, Mitglied des Vorstands der KBV, erläutert, was das für die Praxen bedeutet und wirft zudem einen Blick auf die bevorstehende System-Änderung bei der Finanzierung der Telematikinfrastruktur.

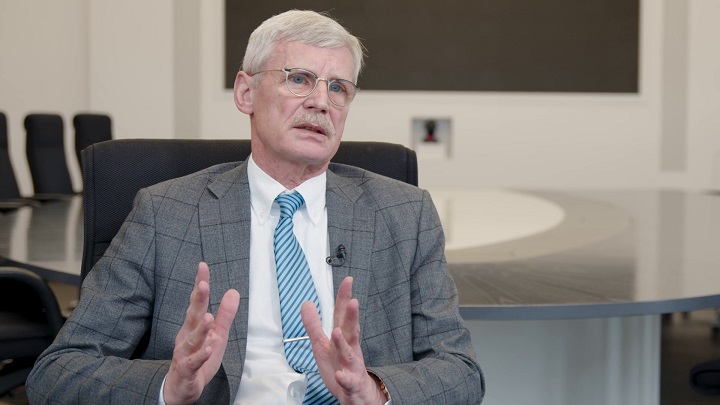
 Feedback
Feedback Zur Mediathek
Zur Mediathek