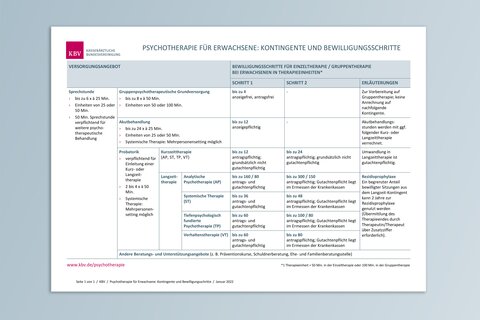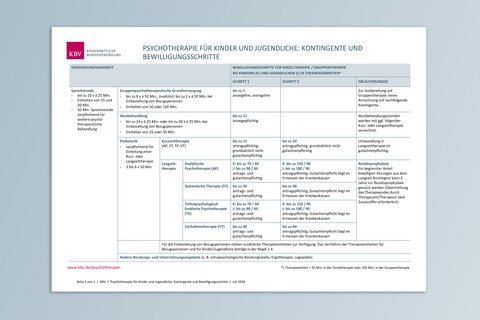Psychotherapie Ambulante psychotherapeutische Versorgung

Überblick zum Versorgungsangebot

Angebote für Patientinnen und Patienten
Abrechnung und Vergütung
Praxisorganisation
Rechtsgrundlagen
Formulare für die Psychotherapie

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten benötigen beispielsweise für die Antragstellung und Begutachtung eine Reihe von Formularen. Hier finden Sie eine Übersicht sowie Ausfüllhilfen zu den einzelnen Formularen.
Die Formulare können über die gewohnten Bezugswege (KVen, Druckereien etc.) bezogen werden. Für einige Formulare ist eine Blankoformularbedruckung möglich. Alle Formulare sind auch in der Praxissoftware hinterlegt.
Ausfüllhilfen und Mustersammlung
Übersicht
PTV 1: Antrag auf Psychotherapie
- 3-fache Ausfertigung (Krankenkasse / Therapeut / Doppelseite für Versicherten)
- Blankoformularbedruckung möglich
PTV 2: Angaben Therapeut
- 3-fache Ausfertigung (Krankenkasse / Gutachter / Therapeut)
- Blankoformularbedruckung möglich
PTV 3: Leitfaden zur Erstellung des Berichts an die Gutachterin oder den Gutachter
PTV 4: Auftrag zur Begutachtung
- Ausstellung nur durch die Krankenkasse
- Muss nicht in der Praxis vorgehalten werden
PTV 5: Gutachten
- Teilweise vorausgefüllt von der Krankenkasse
- 3-fache Ausfertigung (Therapeut / Gutachter / Krankenkasse)
- Muss nicht in der Praxis vorgehalten werden
PTV 8: Briefumschlag
- Zur Weiterleitung der Unterlagen für das Gutachtenverfahren
PTV 10: Allgemeine Patienteninformation
- Im Rahmen der Psychotherapeutischen Sprechstunde
PTV 11: Individuelle Patienteninformation
- Am Ende der Psychotherapeutischen Sprechstunde
- 2-fache Ausfertigung (Versicherter / Therapeut)
- Blankoformularbedruckung möglich
PTV 12: Anzeige einer Akutbehandlung
- 2-fache Ausfertigung (Krankenkasse / Therapeut)
- Blankoformularbedruckung möglich
Erläuterungen zu den einzelnen Feldern
Zum Ende der Sprechstunde erhält jede Patientin und jeder Patient einen Befundbericht mit Ergebnissen und Empfehlungen für das weitere Vorgehen. Die Psychotherapeutin beziehungsweise der Psychotherapeut verwendet dafür das PTV 11 und trägt unter anderem ein, ob eine behandlungsbedürftige psychische Störung vorliegt und ob weitere Maßnahmen erforderlich sind, beispielsweise eine Akutbehandlung oder das Aufsuchen einer Beratungsstelle.
Verordnungen in Psychotherapiepraxen
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten können Verordnungen für die folgenden Bereiche ausstellen:
- Soziotherapie
- Medizinische Rehabilitation
- Krankenhausbehandlung und Krankenbeförderungen
- Ergotherapie
- Psychiatrische häusliche Krankenpflege
In einer Broschüre aus der Reihe PraxisWissen informiert die KBV über wichtige Regeln, die bei der Verordnung der Leistungen zu beachten sind. Hierbei gelten generell dieselben Vorgaben wie für Vertragsärztinnen und Vertragsärzte, so werden zum Beispiel die gleichen Verordnungsformulare verwendet. Darüber hinaus gibt es einige Unterschiede und Besonderheiten, vor allem beim Indikationsspektrum.