Dann steigen wir doch direkt steil ins Thema ein. Was ist für Sie richtig: Therapiefreiheit und Transformation, digitale Transformation oder Therapiefreiheit oder digitale Transformation?
Auf jeden Fall digitale Transformation und natürlich Therapiefreiheit. Ich bin ja von Hause aus auch Ärztin. Insofern ist das natürlich ein ganz großer Teil auch von unserem Schaffen, dass wir natürlich uns durch die diagnostischen Ergebnisse und auch die medizinische Evidenz in verschiedene therapeutische Richtungen beeinflussen lassen. Gemeinsam natürlich immer mit den Patientinnen und Patienten, was die mittragen, was wir auch denken, was für die wichtig und richtig ist. Aber natürlich, die Digitalisierung ist Teil von der Gesundheitsdaten-Analyse, von der diagnostischen Umgebung, in der wir uns heutzutage befinden. Und deswegen geht es nur einher zusammen.
Wie schwer fällt es in den letzten Jahren, das Ihren medizinischen Kolleginnen und Kollegen beizubiegen?
Es ist ganz unterschiedlich. Letztendlich die digitale Transformation, die Digitalisierung, die ist ja unaufhaltsam. Wir erleben es im Alltag überall, dass wir eben nicht nur mit Papier mehr arbeiten, sondern dass alles zunehmend digital ist. Und die Digitalisierung hat ja auch ihren Vorteil. Also früher, das diagnostische Ergebnis auf einem Blatt Papier war nur da vorhanden, wo tatsächlich dieses Stück Papier war.
Und jetzt können wir diese Ergebnisse digital natürlich überall abrufen. Und im Idealfall könnten wir auch die Ergebnisse gemeinsam auswerten und zum Beispiel durch eben so Sachen wie künstliche Intelligenz tatsächlich noch mal mehr Entscheidungs-Unterstützung oder diagnostische Evidenz generieren. Und das ist ein großer Vorteil. Im Grunde ist das wie eine Technikentwicklung. Also früher, als es noch kein Kernspin zum Beispiel gab, da konnte man ja auch nicht die Ergebnisse aus einer kernspintomographischen Untersuchung dann zugrunde legen für die weitere Therapie-Entscheidung. Und so ist es eben mit Gesundheitsdaten, deren Analyse und auch den Möglichkeiten von KI heutzutage auch.
Was war denn so Ihr digitales Schlüsselerlebnis?
Also ich bin nach vier Jahren in der Neurologie tatsächlich in die Neuro-Radiologie gegangen und ja, da gab es noch keine digitale Bildgebung, noch kein Picture Archiving System, noch kein PACS. Also ich sag's immer so ein bisschen verhalten, weil dann alle denken, ach Gott, wie alt ist die denn, ja. Und wir haben tatsächlich an der Uniklinik, damals, als ich da war, das PACS eingeführt und das hat total die Prozesse verändert.
Also für mich als Assistenzärztin hat das wirklich bedeutet, dass ich anderthalb Stunden am Tag gespart habe, die ich vorher über die Stationen gelaufen bin, und habe in Tüten die entsprechenden Aufnahmen gesucht, habe große Lichtkästen, Alternatoren behängt und geguckt, dass die richtigen Aufnahmen untereinander hängen. Und das ging dann einfach auf Knopfdruck und man musste nicht mehr suchen und man konnte sowohl auf Station als auch eben in der Radiologie in der Bildgebung sich die Aufnahmen ansehen und vergleichen zu vorher.
Und das war so ein Zugewinn, dass das wirklich ganz enorm ist. Und das hat mich damals auch tatsächlich veranlasst, aus dem einen Jahr Radiologie sind elf Jahre geworden und das hat mich sehr geprägt.
Das glaube ich. Und was sind so die jetzigen Schlüssel-Entwicklungen?
Also auf der einen Seite bin ich ja auch im sogenannten Interop Council, vertrete da die IT-Anwenderinnen und Anwender in der deutschen Medizin und da muss man ganz ehrlich sagen, also eine Krankheit entsteht ja nicht bei dem einen ärztlichen Kollegen oder Kollegin, wo sich der Patient vorstellt, sondern der hat ja eine ganze Krankheitsgeschichte und überall dort fallen natürlich Daten an und es wäre sehr im PatientInnen-Interesse tatsächlich, wenn man diese Daten gemeinsam auswerten könnte und wenn man dadurch auch ja, also ein stückweit wirklich diese personalisierte Präzisions-Medizin, die wir in der technischen Welt könnten, ja auch wirklich an den Mann, die Frau bringen könnten.
Und das wäre auch für uns als ärztliche Kollegen sehr wichtig. Für mich jetzt im Krankenhaus, natürlich wäre es extrem interessant auch zu sehen, wie sind denn Laborwerte von einem Patienten, einer Patientin in den Jahren zuvor bei den niedergelassenen Kollegen gewesen. Und genauso natürlich auch dann hoffentlich in Zukunft dann eben über die Telematikinfrastruktur die Möglichkeit, diese Werte dann auch später zu kontrollieren und für den Patienten und die Patientin das dann in einer App zusammen auch quasi sichtbar zu haben, auch ein Stück weit Kontrolle darüber zu haben.
Für wie realistisch halten Sie es denn, das klingt ja sehr nach Hightech, dass das eben nicht nur in den Krankenhäusern und Kliniken sich abspielt und gerade auch in den Unikliniken vielleicht, die da ja schon immer ein paar Schritte voraus sind, sondern eben auch in der niedergelassenen Praxis?
Na ja, jetzt haben wir Anfang Juli und tatsächlich, ab 1.7. soll ja auch so was wie das eRezept dann wirklich in die Fläche gebracht werden. Und man muss ganz ehrlich sagen, das ist gar kein Hightech mehr. Also diese digitalen Anwendungen, das ist wirklich etwas, was wir aus anderen Branchen extrem kennen. Und ja, Anwendungen der künstlichen Intelligenz in der Medizin, die sind deswegen ja noch nicht so in der Medizin quasi umgesetzt als in anderen Branchen, weil die natürlich auf besondere, also strukturierte und interoperable, also vergleichbare Daten, zugreifen müssen.
Und das ist etwas, was wir in der Medizin auch durch die sektorale Aufgliederung, aber auch durch die jetzt erst schleppend umzusetzende Interoperabilitäts-Vorgaben haben werden.
Bevor wir kurz noch auf die künstliche Intelligenz eingehen, würde ich Sie gerne bitten wollen, mal kurz zu erklären, was denn ein CTO eigentlich macht. Sie sind ja am Uniklinikum Essen Chief Transformation Officer. Das erklärt sich, glaube ich, nicht allen von selbst.
Ja, also in erster Linie bin ich mal Ärztin und war zuvor Digital Change Managerin. Das haben wir auch erfunden letztendlich diese Berufsbezeichnung. Einfach weil wir gesehen haben, dass es total wichtig ist, auf der einen Seite dieses medizinische Domänen-Wissen zu haben und andererseits aber Digitalisierung in die Fläche zu bringen. Und dann, vor zwei Jahren war ich die erste Chief Transformation Officerin in Deutschland.
Also im Ausland kennt man das überall. Da geht es wirklich darum, die digitale Transformation als Ganzes zu sehen und eben nicht zum Beispiel in der IT, also in zentralen IT-Abteilungen von größeren Firmen sind es Informatiker. Und natürlich brauche ich auch Informatikerin und Informatiker. Aber ganz wichtig in der Medizin ist eben diese Zusammenführung, einerseits das medizinische Fachwissen, auch das pflegerische oder das von der Medizintechnik und dann eben die Umsetzung in Programmierung und auch die Zusammenstellung von vernünftigen klinischen Studien, um das Ganze dann auch in Bezug auf Wirksamkeit zu testen und auch an Anwendungsfreundlichkeit als solches.
Das ist ja tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Feld und das ist ja auch das, was die Ärztinnen und Ärzte ja im Grunde immer einfordern, dass sie sagen, wir wollen mit am Tisch sitzen, wenn es darum geht zu gucken, welche digitalen Anwendungen sollten denn die nächsten sein, welche ergeben Sinn und so weiter und so fort. Und gerade bei der künstlichen Intelligenz scheint sich ja noch mal ein ganz neues Feld aufzutun, auch weil wir schon auch sehr geprägt sind, glaube ich, durch die Popkultur von negativen Erfahrungen, also fiktionalen Erfahrungen mit künstlicher Intelligenz.
Wie erleben Sie das? Wie offen sind Ihre Kolleginnen und Kollegen, sei es jetzt im stationären oder auch im ambulanten Bereich gegenüber der künstlichen Intelligenz? Und inwieweit, glauben Sie, ist es auch eine Vertrauensfrage oder eben eine Evidenz-Frage, wie man sich darauf verlässt, sich darauf einlässt? Und so weiter.
Also auf der einen Seite muss man ganz ehrlich sagen, viele von diesen Anwendungen kommen aus der Radiologie. Einfach, wie ich das am eigenen Leibe erlebt habe, weil wir sehr früh mit strukturierten Daten auch gearbeitet haben, mit Bilddaten gearbeitet haben und den radiologischen Kolleginnen und Kollegen ist das also nichts, was ich besonders vermitteln muss, weil das leuchtet denen noch ein.
Also, wenn ich früher zum Beispiel einen Tumor in der Größe ausgemessen habe und habe da mehrere Achsen reingelegt, geguckt, auf wie viel Schnitten und mit welcher Schnittgröße quasi war das zu sehen, um dann so eine Schätzung zu haben, wie groß ist die Tumorgröße. Und dann drei Monate später kommt dieser gleiche Patient. Ich mache wieder das Gleiche.
Ja, das ist wahnsinnig ungenau. Ich nehme eine mathematische Formel. Also, ich nehme irgendwie an, ist es eine Kugel, ist das ein Quadrat, ist es ein Rechteck. Das wird mal so angeschnitten und mal so angeschnitten und die Ungenauigkeit ist halt extrem. Und die KI erkennt natürlich diesen Dichte-Abfall und kann im Bruchteil einer Sekunde sehr exakt Werte ermitteln an Größe und dann eben auch einen entsprechenden Abfall oder eine Zunahme, also die Veränderung zu diesem ursprünglichen Befund.
Und das ist jetzt nur eine Anwendung, die einem sofort plausibel erscheint, dass eben so eine Rechner-Analyse sehr viel genauer ist und dass man damit natürlich sehr viel mehr dann bestimmen kann. Wenn man mehr Datenquellen einbezieht, zum Beispiel jetzt auch Laborbefunde oder Symptome von Patient, Patientin, kann man natürlich ganz anders, vor allem auch im Sinne von prädiktiver Medizin arbeiten und im Grunde überlegen dann auch, wie könnte so eine Kurve demnächst aussehen, wie kann eine Entwicklung aussehen, zum Beispiel auch in den Bildanalysen, wie ist die Durchblutung zu erwarten, in der nächsten, in den nächsten zehn Minuten, in einer halben Stunde und so weiter. Das heißt, wir haben dadurch ja digitale Bildanalyse-Tools und auch andere, eben Entscheidungs-Unterstützungs-Werte. Letztendlich die Entscheidung über die Therapie trifft immer noch Arzt und Ärztin und das gemeinsam mit Patient und Patientin.
Und auch der Behandlungserfolg, der ist ja maßgeblich davon abhängig, wie das Verhältnis ist zwischen Arzt/Ärztin und Patient/Patientin und nicht jetzt, welcher Score bei irgendwas raus kam. Und es war auch schon immer so, ja, da spielen ja ganz viele Faktoren eine Rolle. Und letztendlich also kann man das auch so ein bisschen vergleichen, wenn man jetzt zum Beispiel Auto fährt und Führerschein hat und dann meldet das Fahrzeug-Cockpit eins von diesen Symbolen. Dann kann ich immer noch natürlich entscheiden, guck ich das nach, halte ich jetzt an oder fahre ich weiter. Oder wenn der Navi sagt rechts abbiegen und da ist eine Einbahnstraße, dann ist das meine Entscheidung, fahre ich da jetzt rein. Es ist aber ja nicht das Auto, was dann sagt, du musst da reinfahren und so ein bisschen, finde ich, kann man das vergleichen. Und letztendlich es untermauert nur eben als Baustein das, was man auch mit Patient/Patientin dann weiter bespricht und wie man verfährt.
Und erhöht die Chance, die Versorgung tatsächlich zu verbessern?
Richtig, also die PatientIn-Sicherheit als solches zu verbessern, die Qualität der Versorgung und, das ist natürlich so ein bisschen, häufig wird das kritisiert, wenn man das sagt, es erhöht halt die Effizienz. Aber man muss sich ja nichts vormachen Wir haben ein riesen Personalmangel. Dokumentation ist verpflichtend vorgeschrieben. Und wenn ich zum Teil diese Dokumentation eben einem digitalen Tool übergeben kann, was dann automatisch dokumentiert und ich kontrolliere das nur noch mal, zum Beispiel jetzt, ja, dann entlastet mich das ja von einer Aufgabe, die eigentlich nicht meine Kernaufgabe ist, sondern ich möchte ja eigentlich ärztlich handeln und insofern finde ich auch diese Effizienz-Verbesserung wichtig für uns. Und ansonsten ist es ja gar nicht zu schaffen. Absolut.
Und das gilt auch wieder gleichermaßen für die Krankenhäuser wie für die Praxen.
Korrekt. Absolut. Und im Grunde wäre das Wichtigste dabei noch, dass wir diese Daten auch schaffen über die sektoralen Grenzen dann miteinander zu kommunizieren und im Idealfall auch miteinander arbeiten zu lassen. Und das ist natürlich etwas. Also das wäre so mein größter Wunsch, dass das gelingt, dass die interoperabel sind und dass das eben zum Wohle des Patienten einfach fließender zwischen den Sektoren dann auch läuft.
Das ist ja das, was mit der elektronischen Patientenakte versprochen wird. Wagen Sie eine Prognose, wann uns das gelingen wird?
Also ich bin tatsächlich auch GKV-Patientin und ich habe eine elektronische Patientenakte. Ich habe auch eine NFC-fähige eGK und einen PIN und ich warte nur auf das erste Rezept, dass ich mal krank werde, dass ich das endlich ausprobieren kann so ein bisschen. Aber es soll ja jetzt wirklich in den nächsten Monaten eher kommen. Ich hoffe wirklich sehr, dass es auch so umgesetzt wird, wie die Digitalstrategie der Bundesregierung das vorgesehen hat, auch mit sehr kurzen Timelines.
Bis jetzt haben wir sehr viel über die Vorteile gesprochen. Sehen Sie auch Herausforderung für die gerade Therapiefreiheit vielleicht? Ein paar sind ja schon angeklungen. Oder sehen Sie ausschließlich Vorteile?
Also ich glaube, das, was wir am allermeisten mitbedenken müssen, ist, dass sich auch dadurch Dinge verändern. Also die Digitalisierung bringt wirklich einen neuen Player mit auf dieses Spielfeld und das ist der Patient, die Patientin. Und mit dem-, derjenigen zusammenzuarbeiten ist eine neue Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Und wir müssen halt auch die ganzen möglichen ethischen und auch Verzerrungen, also BIAS-Dinge beachten.
Also alleine bei so Sachen wie Smartphone ist es heute gang und gebe, dass man eine Gesichtserkennung hat, dass man es gar nicht mehr entsperren muss. Wenn ich natürlich, dann nur Trainingsdaten jetzt als Beispiel hinterlege, die von der Hautfarbe weißen Kaukasiern sind, dann wird es schlechter funktionieren. Insofern also muss man auf solche Verzerrungen immer sehr achten und dann nicht irgendwie falsche Rückschlüsse ziehen.
Also weder jetzt im Sinne von Gender und Gender-Medizin, auch alles mit Migration oder auch Tonhöhe. Also wenn man zum Beispiel eine multimodale Steuerung von Geräten macht, dann muss man auch die Körpergröße auch für kleinere, vielleicht Frauen berücksichtigen und nicht nur für große Männer und eben auch die Tonhöhen und also nicht quasi immer nur durch Männer trainieren lassen, sondern auch durch Damenstimmen.
Das sind so Dinge, die wir einfach auf dem Schirm haben müssen und die sich dem ärztlichen Dasein und Handeln so eben nicht erschließen. Und dadurch ist eben eine Geschichte, die ganz wichtig ist, dass wir interprofessionell zusammenarbeiten müssen und dass man wirklich mit auch ITlerinnen und ITlern genauso wie mit anderen Medizintechnik, Pflegefachberufen und so weiter auf Augenhöhe zusammenarbeiten muss und eben mit dem Patienten auch.
Es ist ja auch dann für die Patientinnen und Patienten herausfordernd. Die müssen ja jetzt auch ganz viele Fragen beantworten können, teilweise per Klick. Also Stichwort auch Opt-in, Opt-out bei der ePA und aber auch andere Situationen, die sie vorher so noch nie treffen mussten, die ja im Grunde ihre Ärztinnen und Ärzte für sie getroffen haben oder eben auch die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Wo verorten Sie die Aufgabe dieser Aufklärung, Begleitung und auch das Upskilling der Patientinnen und Patienten im Sinne von also sie dazu befähigen, solche Entscheidungen zu treffen?
Also Aufklärung ist ganz klassisch natürlich eine ärztliche Aufgabe, da geht kein Weg dran vorbei. Wir erleben sehr, dass gerade Patientinnen und Patienten im mittleren und jüngeren Alter, vielleicht auch für elektive Eingriffe, natürlich ganz anders Informationen vorher konsumieren, bevor sie eben in eine Praxis oder ein Krankenhaus gehen. Und dass die quasi ganz anders bei uns ankommen.
Die Schwierigkeit ist natürlich, dass in der Medizin dürfen wir niemand ausschließen. Das heißt, wir können nicht einfach Prozesse komplett digital umstellen, damit wir dann auch gerade die älteren Patientinnen und Patienten mitnehmen und die auch natürlich genauso gut versorgen. Und das ist sicher ein Spannungsfeld, eine Aufgabe, die schwierig ist, weil sie einfach auch sehr zeitintensiv ist. Und eine entsprechende Aufklärungsarbeit und ich will nicht sagen Kampagne auch in Richtung Vertrauen auf eben digitale Techniken und auch KI in der Medizin, das ist auch eine politische Aufgabe. Auf jeden Fall. Und da finde ich, ist es manchmal in Deutschland so ein bisschen schlecht gelaufen, weil wir jetzt zum Beispiel mit dem eRezept dann auch schon wieder als erstes drüber diskutieren, das wurde doch aber schon mal gehackt und der Chaos Computer Club hat das doch alles bewiesen, dass das alles so schlecht ist.
Und ich glaube, da müssen wir uns manchmal ein bisschen an der eigenen Nase packen und sagen, wir müssen einfach mal machen und es umsetzen. Und von den Nachbarn in Europa lernen, die das ja wirklich flächendeckend schon umgesetzt haben.
Gut, die haben teilweise auch andere Rahmenbedingungen oder ein anderes System. Manche Dinge fallen dort vielleicht leichter als hier, aber trotzdem es muss ja passgenau sein. Brauchen wir dann aber auch eine Kampagne in Richtung Ärztinnen und Ärzte?
Ja, das ist eine gute Frage. Also häufig erlebe ich, dass die Anwendungsmöglichkeiten, die eigentlich für digitale Techniken sehr einfach sein könnten, durch eben ich will nicht sagen Bürokratie, aber auch durch verschiedene Auflagen, sei es jetzt der persönlichen Identifizierung, PIN-Eingaben usw., doch die Prozesse so ein bisschen, ich will nicht sagen blockieren, aber verlangsamen. Und das ist dann natürlich schlecht im Sinne der Akzeptanz, weil wenn man dann das Gefühl hat, oh, jetzt muss ich schon wieder irgendeinen PIN eingeben oder muss mich wieder authentifizieren, nur eben um sicherzustellen, dass das jetzt wirklich von mir abgesegnet ist, dann macht es den Kolleginnen und Kollegen naturgemäß keinen Spaß und da müssen wir einfach so ein bisschen finde ich einen besseren Mittelweg finden und dieses Nutzungs-Erlebnis für alle Beteiligten, also fürs Personal genauso wie für Patient/Patientin mal so ein Aha-Erlebnis zulassen und eben so Schwung da reinbringen. Also ich hatte kürzlich eine Veranstaltung gesehen, da meldete sich ein Patient und das war ein junger Patient. Also wirklich richtig jung.
Ein Lymphom-Patient, also mit einer bösartigen Erkrankung, der dann berichtete, er war umgezogen in eine andere Stadt und dann hatte man ihn zu einem Kontroll-CT drei Jahre quasi nach seiner Erkrankung geschickt. Und die niedergelassene Radiologen hat ihn dann gefragt, ja, ich sehe da was, aber ich weiß jetzt nicht, war das vorher schon da oder nicht. Und dann zog er sein Handy raus und sagte, kein Problem, ich habe ja die und die Aufnahmen, was soll ich Ihnen übermitteln.
Und sie sagte, ja, dann schicken Sie mal alles rüber. Und hätte dann alles rübergeschickt und sie hat das angeguckt und hat gesagt, super, alles bestens. Also, da ist nichts Neues drin, brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen. Und da machte der so eine Pause und sagte, so hätte ich mir das vorgestellt, aber. Und dann kam eine Geschichte, der Wahnsinn. Der unterschrieb, dass er es per Email bekommen darf.
Er hat eine CD-ROM mitgenommen. Er hat die CD-ROM dann quasi ins Krankenhaus geschickt. Er hat dann dort angerufen, hat ein Passwort geschickt, weil er konnte sich übers Internet den Befund runterladen, aber nur er als Patient. Dann hat er den Befund dort auch quasi hingeschickt. Also es war eine riesen Geschichte und er hat über zwei Monate gebraucht, bis dann quasi es klar war, dass nichts neues im CT war. Dass alles okay ist. Und das geht nicht. Da ist wirklich, da ist mir das Herz richtig schwer geworden. Also das kann man einem Menschen nicht antun heutzutage. Und wir können Bilder schon lange von A nach B schicken. Wir müssen die nicht mehr wie früher eintüten und im Taxi oder im Hubschrauber irgendwo hinfahren. Das wär möglich. Und das wäre so eine tolle Anwendung, wenn sowas endlich mal möglich wäre. Dann hätten auch alle diesen Nutzen und dieses Erlebnis, dieses Aha-Erlebnis quasi von seitens Arzt/Ärztin genauso wie für Patient und Patientin. Und nur funktionierende Digitalisierung die bringt einen Mehrwert und die fördert auch die Akzeptanz.
Ich glaube, das ist der springende Punkt. Sie muss eben auch funktionieren. Das ist das eine Thema. Das heißt im Grunde genommen auch für das, was ja für viele bei dem Thema Therapiefreiheit, freier Beruf, freier ärztlicher Beruf mitschwingt, das Arzt-Patienten-Verhältnis oder die Arzt-Patienten-Beziehung ist ja ein sehr hohes Gut, durchaus auch profitieren kann durch digitale Transformation.
Absolut. Also wenn die quasi Informationen dann vorliegen, dann hat man ja auch mehr Zeit, sich wirklich diesem empathischen Gespräch und auch dem Beratungsgespräch im Grunde zu widmen. Und man hat halt auch noch mal zusätzliche diagnostische Bausteine. Also im Grunde geht es ja auch darum, dass wir durch eben diese digitalen Anwendungen haben wir ja viel mehr Daten, die wir als Menschen gar nicht mehr einfach so auswerten können.
Also das ist nicht mehr so die Blickdiagnose oder das EKG-Lineal anlegen, sondern häufig fallen da ja so viele Datenpunkte an, die natürlich dann maschinell ausgewertet werden und die uns dann wieder einen diagnostischen Hinweis geben. Und das also dann mit dem Patienten, der Patientin zu erörtern, wo die Analyse selbst dann eine Maschine erstellt hat, das ist ja nicht das Schlechteste. Ja, absolut.
Sie sind so richtig am Puls der Zeit und ich vermute, dass Sie sowohl für Ihr privates Umfeld eine Idee haben, als auch vielleicht für das berufliche. Was ist denn so die digitale Anwendung der kommenden Jahre vielleicht, von der Sie sich am allermeisten versprechen?
Also tatsächlich ist für mich die ePA das A und O, weil wir müssen ja diese zum Teil doch erheblichen Sektorengrenzen fürs medizinische Personal genauso wie für Patient/Patientin überwinden und da könnte eine funktionierende ePA die wirklich interoperable Daten, also den gleichen Speicherwegen und miteinander kompatiblen Formaten, könnte ein entscheidender Vorteil sein, der dann auf der einen Seite die Patientinnen und Patienten ermächtigt, dass die halt sehen, ich habe hier auch meine Daten mit drin und auf der anderen Seite dann auch das ärztliche Dasein einfach erleichtern, weil man an Vorbefunde dann viel leichter kommt und die entsprechend freigeben kann. Insofern ist für mich die ePA wirklich eine ganz kritische Anwendung, von der wir alle so wahnsinnig profitieren könnten.
Und wie das gehen kann, davon haben Sie uns jetzt einen wunderbaren Einblick gegeben, Frau Doktor. Ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Mir auch.

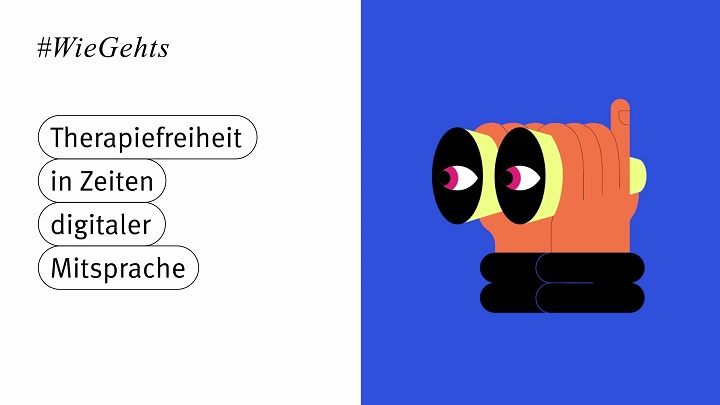
 Feedback
Feedback Zur Mediathek
Zur Mediathek