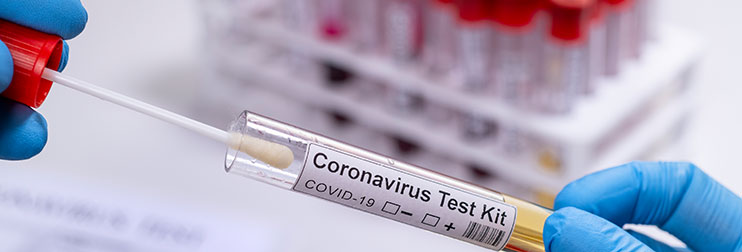Testungen bei Patienten mit COVID-19-Symptomen
Vertragsärztinnen und -ärzte können bei gesetzlich krankenversicherten Patientinnen und Patienten mit COVID-19-Symptomen weiterhin einen Abstrich für einen PCR-Test durchführen und die Untersuchung im Labor beauftragen. Möglich ist auch ein Antigentest im Labor.
Formular
Praxen verwenden für die Beauftragung eines SARS-CoV-2-Nachweises im Labor das Formular 10.
Vergütung
- Die Vergütung für den Abstrich ist weiterhin in der jeweiligen Versicherten- und Grundpauschale enthalten.
- Labore rechnen wie bisher für den PCR-Test die Gebührenordnungsposition (GOP) 32816 und für den Antigentest die GOP 32779 nach EBM ab.
Hinweis: PCR-Test (GOP 32816) und Labor-Antigentest (GOP 32779) belasten nicht das Laborbudget der Arztpraxis.
Für nicht gesetzlich versicherte symptomatische Personen gelten die Bestimmungen des jeweiligen Kostenträgers, z.B. private Krankenversicherung.
Meldepflicht
Für COVID-19-Erkrankungen, den Verdacht auf die Erkrankung und Erregernachweise besteht weiterhin eine gesetzliche Meldepflicht. Seit dem 1. Januar 2021 besteht gemäß § 14 Absatz 8 Sätze 3 bis 5 Infektionsschutzgesetz die Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung von direkten und indirekten Erregernachweisen für SARS-CoV-2 im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes.
Infektionsschutzgesetz
Postleitzahltool des RKI zur Ermittlung des zuständigen Gesundheitsamtes