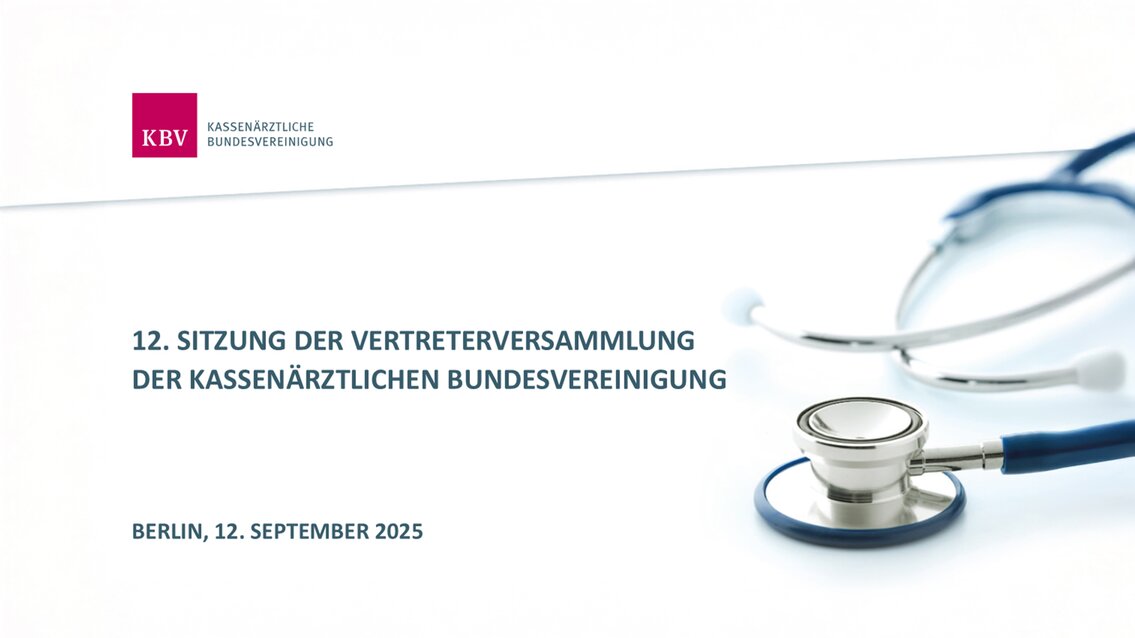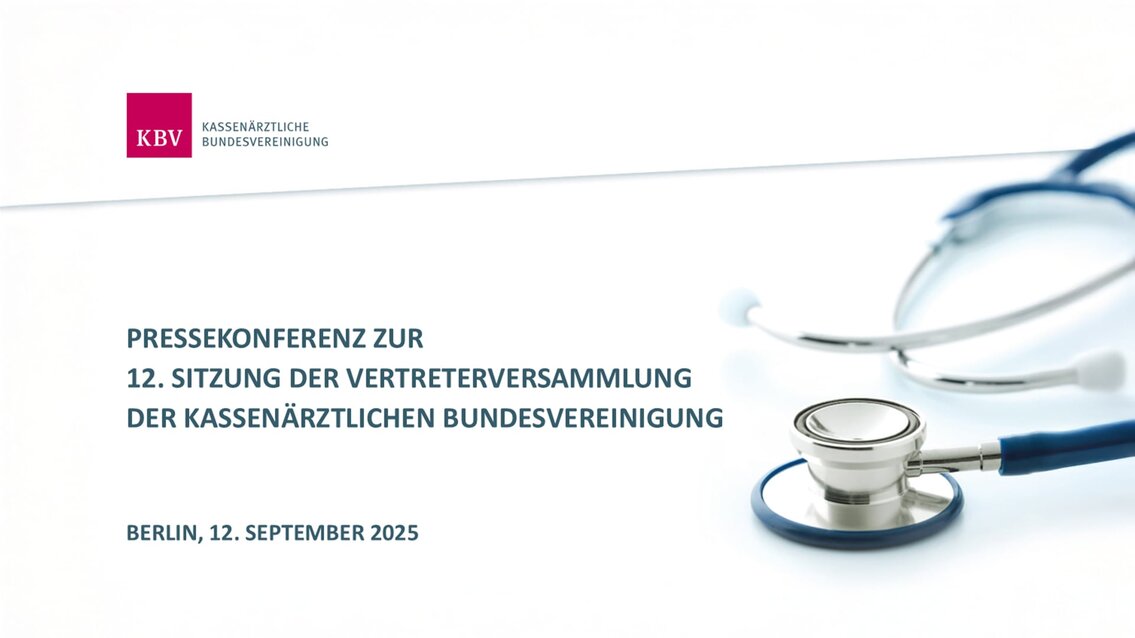Sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Petra, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich begrüße Sie zur heutigen Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.
Sie alle haben es gehört oder gelesen: Die Bundesregierung hat einen „Herbst der Reformen“ mit, O-Ton Kanzler Friedrich Merz, „schwierigen Entscheidungen“ angekündigt. Führende Politiker – und nicht nur die – sehen dies als letzte Chance der Regierung zu beweisen, dass Politik überhaupt noch reformfähig ist. Dass dieser Beweis nicht nur auf internationaler Bühne, auf der Deutschland ohne jede Frage nach der quasi „Nichtexistenz“ unter Kanzler Olaf Scholz wieder sichtbar ist und gehört wird, sondern vor allem auch im Inland notwendig ist, scheint mittlerweile allen klar geworden zu sein. Zwischenzeitlich musste man allerdings Sorge haben, dass die schwarz-rote Koalition zu einer „Ampel reloaded“ wird, in der mehr gegen- als miteinander gearbeitet wird. Um diesen Zustand zu überwinden, traf man sich kürzlich in Würzburg zur „schwarz-roten Gruppentherapie“, wie „Tagesschau online“ titelte. Substanzielle Ergebnisse drangen allerdings nicht nach außen, die Hauptnachricht waren gemeinsame Selfies auf einer Mainbrücke – das macht einen eingedenk der Erinnerung an Ampel-Selfies nicht direkt zuversichtlich. Aber warten wir es ab.
Die innenpolitischen Themen sind gesetzt. Neben den Themen Migration und innere Sicherheit sind die Zukunft des Sozialstaates und das System der Sozialversicherungen zwei der größten politischen Baustellen. 2024 betrug der Anteil der Sozialleistungen am Bruttoinlandsprodukt rund ein Drittel. Folgerichtig will die Bundesregierung sich in ihrem „Herbst der Reformen“ auch um eine Reform des Sozialstaats kümmern, was ehrlich gesagt nicht nur nach schwierigen Entscheidungen, sondern nach einer, zweifelsohne notwendigen, Herkulesaufgabe klingt. Aber es hilft ja nichts, weiter wie das sprichwörtliche Kaninchen auf die Schlange zu starren. Die Kommission zur Reform des Sozialstaats tagt bereits, ich werde die KBV in der kommenden Woche im Rahmen eines sogenannten Stakeholder-Gesprächs dort vertreten.
Die angekündigte Expertenkommission zur Stabilisierung der GKV-Finanzen soll nun ebenfalls noch in diesem Monat ihre Arbeit aufnehmen und im Frühjahr 2026 erste Ergebnisse vorlegen. Das ist auch nötig, denn in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) geht die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben immer stärker auseinander. Haupttreiber der Kosten sind vor allem zu hohe und ungesteuerte Ausgaben für die Krankenhäuser sowie für Arzneimittel, wie sowohl das Bundesamt für Soziale Sicherung als auch der Bundesrechnungshof in ihren jüngsten Gutachten bestätigen. Der Bericht des Bundesrechnungshofes attestiert darüber hinaus dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) unter der Vorgängerregierung schwerwiegende zeitliche Verzögerungen und komplette Versäumnisse hinsichtlich erforderlicher Strukturreformen. Nun steckt der Karren noch tiefer im Dreck und Ministerin Nina Warken muss als Krisenmanagerin herhalten.
Als kleine Hilfestellung hat der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung in Gestalt seines neuen Vorsitzenden, Herrn Oliver Blatt, kürzlich seine Vorschläge zur Stabilisierung der GKV-Finanzen vorgelegt. Neben der schon bekannten Forderung nach einem Ausgabenmoratorium sehen diese drastische Eingriffe in die ambulante Vergütungssystematik vor. Dazu gehört eine Rückkehr zur Budgetierung sämtlicher vertragsärztlicher Untersuchungen und Behandlungen. Ausgabensteigerungen für ambulante Leistungen, Kliniken und Arzneimittel sollen strikt an die Einnahmen gekoppelt und Vergütungsanpassungen so gestaltet werden, dass Beitragssatzerhöhungen ausgeschlossen sind. Außerdem soll die Prognose des GKV-Schätzerkreises künftig maßgeblich sein – also nicht die Grundlohnsummensteigerung, sondern die Einnahmen des Gesundheitsfonds.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist nicht nur eine Rolle rückwärts hinter die mühsam erreichten Fortschritte der letzten Jahre, endlich eine faire und angemessene Finanzierung vertragsärztlicher und vertragspsychotherapeutischer Leistungen zu erreichen. Es ist ein Salto mortale für die ambulante Versorgung und das Gesundheitswesen insgesamt.
Der Euphemismus der „einnahmenorientierten Ausgabenpolitik“, wie Herr Blatt seine Einlassungen nennt, mag im ersten Moment stimmig klingen, heißt aber nichts anderes als „Versorgung nach Kassenlage“. Sprich: Nicht der medizinische oder psychotherapeutische Bedarf der Patientinnen und Patienten entscheidet über die Art ihrer Versorgung, sondern die Zahlungswilligkeit der Krankenkassen! Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist der Anfang vom Ende des Solidaritätsgedankens in der gesetzlichen Krankenversicherung und eine Bankrotterklärung für den Sozialstaat, der Deutschland immer noch ist.
Wenn Herr Blatt gleichzeitig die Erwartung formuliert, ein Ausgabenmoratorium und die von ihm vorgeschlagenen Strukturreformen sollten zu mehr Terminen für die Versicherten führen, weiß man nicht, ob es absichtliche Irreführung oder schlichte Unkenntnis der ambulanten Versorgung ist. Denn richtig ist: Terminknappheit und längere Wartezeiten werden die Folge sein, es werden noch mehr Ärztinnen und Ärzte vorzeitig den Bettel hinschmeißen und Praxen aus der Versorgung ausscheiden. Denn auch jetzt und immer noch werden viele erbrachte Leistungen der niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen nicht voll vergütet. Mit seinen Plänen will der GKV-Spitzenverbandsvorsitzende diesen unsäglichen Zustand nun auch auf die Bereiche ausdehnen, die bisher wohlweislich extrabudgetär, also vollständig bezahlt werden, wie etwa Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen. Die gerade mühsam ausgehandelte und im Übrigen auch politisch gewollte Entbudgetierung der hausärztlichen Versorgung sowie der Kinder- und Jugendmedizin soll nach seinem Willen rückabgewickelt werden.
Als Begründung für seine Kürzungsfantasien führt der GKV-Spitzenverband an, dass der Ausgabenanstieg im ambulanten Bereich im ersten Halbjahr 2025 unter anderem auf den Anstieg des Orientierungswertes für die vertragsärztliche Vergütung und auf eine starke Zunahme des ambulanten Operierens, bedingt durch die Einführung der Hybrid-DRG, zurückzuführen sei. Genau das war aber doch gewollt: ein längst überfälliger und zudem unzureichender Ausgleich der Finanzierung für die ambulante Versorgung, die seit Jahren allen anderen Indizes hinterherhinkt, sowie eine stärkere Ambulantisierung der Versorgung, um dem medizinischen Fortschritt gerecht zu werden und die davongaloppierenden Krankenhausausgaben in den Griff zu kriegen. Diesen Weg gilt es konsequent weiterzugehen, statt jetzt auf halbem Weg eine Kehrtwende zu vollziehen.
Über all diese Aspekte hinaus würde das Anbinden der Gesamtvergütung an die Einnahmen der GKV auch ein Aushöhlen der gemeinsamen Selbstverwaltung bedeuten. Denn ob ein Ausgabenwachstum für vertragsärztliche Leistungen auch unterhalb der Einnahmensteigerung eventuell beitragssatzrelevant wird, kann nur die Kassenseite beurteilen. Wir als KBV haben keinen Überblick über die Gesamtentwicklungen und Vereinbarungen zu den Ausgaben.
Dementsprechend würden diese Pläne nicht nur eine Versorgung nach Kassenlage bedeuten, sondern auch die Hoheit über entsprechende Entscheidungen in die Hände eines von mehreren Vertragspartnern legen. Für alle, die Verantwortung tragen für die medizinische und psychotherapeutische Versorgung der Menschen in unserem Land, Praxen genauso wie Krankenhäuser und Apotheken und letztlich auch die Krankenkassen, ist dieser Vorstoß untragbar und fast schon fahrlässig.
Das heißt nicht, dass es keiner Maßnahmen zur Konsolidierung der Ausgaben in der GKV bedarf – obwohl die Einnahmen auf Rekordniveau liegen. Aber vielleicht sollten die Krankenkassen hier auch einmal vor der eigenen Haustür kehren – ich empfehle die eine oder andere Analyse von Beratungsunternehmen, die nahelegt, dass Krankenkassen Milliardenbeträge an Ausgaben selbst einsparen könnten, etwa durch mehr Effizienz in ihrer Verwaltung, durch Verbesserungen im Prüfwesen und durch Digitalisierung.
Wenn wir über eine Begrenzung der Ausgaben nachdenken – und das müssen wir zweifellos –, dann kann die sozialromantische Wohlfühl-Devise künftig nicht mehr lauten: Jeder bekommt alles zu jeder Zeit, dafür darf es aber nur wenig kosten. Sondern die Devise muss lauten: Jeder bekommt, was er braucht zum notwendigen Zeitpunkt – und das zahlt die Kasse dann auch zum vollen Preis. Alles andere sind Wunschleistungen, für die nicht die Solidargemeinschaft aufkommen kann.
Und deshalb bleibe ich dabei: Besser als beispielsweise eine Kontaktgebühr für jeden Arztbesuch, wie sie der Geschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände kürzlich vorschlug, wäre es, die Versicherten selbst entscheiden zu lassen, ob sie nur zuzahlungsfreie Kernleistungen in Anspruch nehmen oder ob sie bereit sind, für mehr Leistungen und mehr Freiheiten auch mehr zu zahlen. In einem entsprechenden GKV-Tarifmodell könnte je nach gewähltem Tarif definiert werden, welche Leistungen unter welchen Bedingungen zuzahlungsfrei in Anspruch genommen werden könnten. Hier würde das Sozialgesetzbuch (SGB) V mit seinem WANZ-Prinzip (wirtschaftlich, angemessen, notwendig und zweckmäßig) als Richtschnur dienen. Leistungen jenseits dieses Rahmens wären nicht mehr durch die Solidargemeinschaft zu tragen, sondern müssten durch individuelle Eigenbeteiligungen von den Versicherten selbst finanziert werden. Damit wäre sichergestellt, dass eine vierte ärztliche Meinung oder ein medizinisch nicht erforderlicher Kernspin zur persönlichen Beruhigung des Patienten nicht auf Kosten der Solidargemeinschaft geht. Wenn die Inanspruchnahme von GKV-Leistungen dann auch noch nach medizinischen Kriterien sinnvoll gesteuert würde, dann würde das Geld der Krankenkassen auch ausreichen. Und unnötige Arztkontakte ließen sich beispielsweise durch Abschaffung der ärztlichen Krankschreibungspflicht für die ersten drei Tage verringern. Mit Karenztagen oder arbeitsvertraglichen Regelungen könnten die im EU-Vergleich rekordverdächtigen Krankenstände adressiert werden.
Noch einmal zur Erinnerung für all jene, die die Zahlen nicht im Kopf haben: Selbst Einschnitte in erheblichem Umfang bei der Vergütung der ambulant tätigen Ärzte wären zwar unumkehrbar disruptiv für die Versorgung, aber ein eher geringer Sparbeitrag für die GKV, angesichts eines Anteils von 16 Prozent an den Gesamtausgaben. Selbst die Ausgaben für Medikamente sind höher, sie machen bereits 18 Prozent aus – Tendenz steigend. Für die Krankenhäuser schlagen mittlerweile über 100 Milliarden Euro zu Buche und damit rund ein Drittel der GKV-Gesamtausgaben. In diesen Kosten für die Krankenhäuser sind die rund 35 Milliarden Euro, die jetzt noch mal für Transformation, Cybersicherheit und viele andere diffuse Dinge – es gab mal einen Kanzler, der nannte das Gedöns – obendrauf kommen, noch gar nicht enthalten. Hier unterschreibt die Politik weiterhin Blankoschecks, als gäbe es kein Morgen. Trotzdem wird das unnötige und versorgungstechnisch irrelevante Krankenhäuser nicht retten, es ist rausgeworfenes Geld. Und das auch noch für weitgehend abstrakte Vorhaben, während die Ärzteschaft konkrete Investitionen in die gesundheitliche und digitale Infrastruktur, wie den Ausbau der 116117 – was, nebenbei bemerkt, nur einen Bruchteil des Geldes kosten würde, das die Kliniken kriegen – doch bitteschön aus eigenen Mitteln stemmen soll. Gleichzeitig drainieren, je nach Lesart, 44 bis 60 Milliarden Euro für versicherungsfremde Leistungen die GKV – also mehr als für die gesamte ambulante Versorgung –, unter anderem rund 10 Milliarden Euro für die Finanzierung der Gesundheitsleistungen für Bürgergeldempfänger, während die rund 18,5 Milliarden Euro Steuern für Tabak und Alkohol in den allgemeinen Bundeshaushalt fließen. Finde den Fehler! Es stellt sich daher zwingend die Frage: Ist wirklich kein Geld da oder wird es nur falsch ausgegeben? Die Antwort kennt mittlerweile in Deutschland wohl jeder.
Vor kurzem wurde in der Presse kolportiert, ich hätte mich für die Abschaffung von Mutter-Kind-Kuren ausgesprochen. Das habe ich nicht. Es ging mir vielmehr um die Diskussion, aus welchem Topf derartige Maßnahmen finanziert werden sollen. Über die Kosten des Sozialstaates wurde in letzter Zeit viel geredet. Ein Sozialstaat, der den Schwachen und Kranken hilft oder die alleinerziehende Mutter unterstützt, ist eine segensreiche Errungenschaft. Diese solidarisch finanzierte Errungenschaft war aber nicht dazu gedacht, das Recht auf Faulheit für einige finanziell zu fördern. Über diese Dinge muss gesprochen werden. Das ist auch keine „Bullshit-Debatte“, denn werden diese Fragen, bei einer Staatsquote von inzwischen rund 50 Prozent, nicht zeitnah für die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung zufriedenstellend geklärt, werden sich die Bürger von dem Staat abwenden, der sie nicht hört.
Es gibt eine medizinische Diagnose, die dem aktuellen politischen Umgang einiger Akteure mit diesen wichtigen Problemen einen Namen gibt: Agnosie – die Unfähigkeit, Dinge zu erkennen. Weil wir Ärzte und Psychotherapeuten sind, werden wir versuchen, zu helfen und die Dinge immer wieder aufzuzeigen und zu erklären. Sei es der Politik oder unseren Patienten, die oft auch nicht mehr verstehen, warum Teile der Politik offenkundige Sachverhalte nicht wahrnehmen können und die völlig offensichtlichen Maßnahmen nicht umsetzen.
Mit anderen Worten: Ja, wir müssen natürlich über eine Begrenzung von Leistungen des Sozialstaates reden. Und man muss dann auch über eine mögliche Verkleinerung des Leistungskatalogs reden, wenn man Ausgabenbegrenzungen diskutieren will. Wir als KBV sind immer bereit zu einer sachlichen Diskussion, verweigern uns aber Spargesetzen mit der Heckenschere. Wir lehnen es auch ab, als Ärzte und Psychotherapeuten für nicht gedeckte Schecks der Politik geradezustehen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht verwundert es Sie nach dem bisher Gesagten fast, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass wir bei allen unterschiedlichen Interessen und Bewertungen mit dem GKV-Spitzenverband unter Leitung von Frau Stefanie Stoff-Ahnis in den diesjährigen Verhandlungen zum Orientierungswert für die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung zwar hart, aber sehr sachlich verhandeln. Das Initialangebot der Krankenkassen war erwartbar unzureichend. Es wurde weder den steigenden Kosten noch der allgemein angespannten Lage in den Praxen gerecht. Sowohl die zuletzt stark gestiegenen Ausgaben für nichtärztliches Personal als auch die Inflation, der die Praxen seit Jahren hinterherlaufen, müssen angemessen berücksichtigt werden. Bei den Verhandlungen zur Weiterentwicklung des Orientierungswertes 2026 haben wir als KBV eine Erhöhung um 5,52 Prozent gefordert, die Krankenkassen haben 1,06 Prozent geboten – auch unter Verweis auf ihre hohen sonstigen Ausgaben. Beide Verhandlungspartner stehen unter erheblichem Druck. Fakt ist aber, dass 97 Prozent der Versorgung in den Praxen der Niedergelassenen stattfindet, für einen Anteil von knapp 16 Prozent der GKV-Ausgaben. Das ist wohl auch dem GKV-Spitzenverband klar – insbesondere beim Betrachten der trotz ständig sinkenden Fallzahlen ungebremst in die Höhe schießenden Kosten der Krankenhäuser.
Auch wenn die Positionen initial weit auseinanderlagen, gehe ich davon aus, dass wir nach Wochen der Verhandlung eine Einigung ohne einen Schlichterspruch erreichen können. Auch die GKV-Seite weiß, dass wir als Partner der gemeinsamen Selbstverwaltung unsere Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen sollten.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, da Stephan Hofmeister heute krankheitsbedingt abwesend ist, will ich noch kurz etwas zu den Verhandlungen mit dem GKV-Spitzenverband zur hausärztlichen Vergütung sagen. Nach intensiven und letztlich konstruktiven Beratungen ist es uns gelungen, die von Karl Lauterbach im Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz (GVSG) vorgesehene neue Vorhaltepauschale für die hausärztliche Versorgung so zu gestalten, dass trotz der absurden gesetzlich vorgeschriebenen Ausgabenneutralität mehr Anreize gesetzt werden können und gleichzeitig eine große Umverteilung, inklusive drohender Honorarverluste für bestimmte Praxen, vermieden wird.
Das war nicht trivial, da die gesetzliche Vorgabe lautet, dass es keine Mehrausgaben geben darf, gleichzeitig aber substanzielle Veränderungen des Leistungsangebotes in den Praxen fordert. Geld von einer Praxis auf eine andere umzuverteilen, kann nicht funktionieren – wir brauchen alle Praxen. Das sah auch der GKV-Spitzenverband so. Strukturveränderungen kann man anstreben, diese müssen aber mit zusätzlichem Geld finanziert werden. Jetzt wird die bereits existierende Vorhaltepauschale ab Januar 2026 neu bewertet. Praxen, die bestimmte Kriterien aus einem Katalog zur hausärztlichen Grundversorgung erfüllen, wie etwa Schutzimpfungen oder Pflegeheimbesuche, erhalten je nach Zahl und Umfang der Leistungen und abhängig von der Praxisgröße einen Zuschlag zur Vorhaltepauschale. Für diabetologische Schwerpunktpraxen, HIV-Schwerpunktpraxen und Substitutionspraxen gibt es Ausnahmeregelungen.
Mit den Beratungen zu der vom Gesetzgeber geforderten und ebenfalls skurril formulierten Versorgungspauschale für Patienten mit leichteren chronischen Erkrankungen im hausärztlichen Bereich haben wir begonnen. Wegen der zeitintensiven Verhandlungen zur Vorhaltepauschale war es nicht möglich, hier fristgerecht bis Ende August zu einem gangbaren Ergebnis zu kommen. Die Gespräche laufen weiter. Ich hoffe, dass es uns auch hier gelingt, trotz der auch hier schwierigen und wenig praxistauglichen gesetzlichen Vorgaben bald eine gangbare Lösung zu finden.
Ich will nochmal deutlich betonen, dass diese Probleme vorhersehbar waren. Wir haben dies unmittelbar nach Bekanntwerden der Gesetzgebungspläne deutlich angemerkt und konkrete Verbesserungsvorschläge eingebracht. Diese wurden ignoriert. Herausgekommen ist eine unsinnige Regelung und ein gesetzgeberischer Fehler. Eine Veränderung der Honorarsystematik in dieser Form ohne zusätzliches Geld macht schlechterdings keinen Sinn. Eine Umverteilung von den vermeintlich schlechten zu den vermeintlich guten Hausarztpraxen im Sinne einer Autotransfusion hätte viele, insbesondere kleinere Praxen existenziell bedroht und damit die Versorgung in der Fläche. Ein Irrsinn in Zeiten, in denen mittlerweile 40 Prozent der Hausärztinnen und Hausärzte über 60 Jahre alt sind und etliche von denen als Folge einer solchen Regelung mit erheblichen Umsatzeinbußen für ihre Praxen ihre Tätigkeit eingestellt hätten. Eine solche Strukturänderung kann man nur mit zusätzlichem Geld anstoßen. Alles andere ist entweder naiv oder ideologisch rücksichtslos, auf jeden Fall aber versorgungspolitisch unverantwortlich.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, man kann durchaus von bewegten Zeiten sprechen, in denen wir als KBV gemeinsam mit der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung am 23. September hier in Berlin 70 Jahre ärztliche Selbstverwaltung feiern. Ich freue mich, dass Bundesgesundheitsministerin Nina Warken ihr Kommen zugesagt hat. Ich sehe dies als Zeichen der Wertschätzung und als Bekräftigung ihres Versprechens zu Beginn ihrer Amtszeit, auf die Expertise und einen engen Dialog mit der Selbstverwaltung setzen zu wollen. Wir haben uns zu allen anstehenden Gesetzesvorhaben geäußert und Stellung bezogen; nun müssen längst angekündigte Vorhaben wie etwa die rechtliche Klarstellung bei der Sozialversicherungspflicht im ärztlichen Notdienst, die Bagatellgrenze für Wirtschaftlichkeitsprüfungen und etliche weitere, die Arbeit der Niedergelassenen erleichternde Dinge endlich kommen, denn diese Themen sind wirklich ausdiskutiert.
Noch vieler weiterer Diskussionen, vor allem aber entschlossenem politischem Handeln wird es hingegen bedürfen, Deutschland als Sozialstaat, als Wirtschaftsmacht und als Hüter der Demokratie zukunftsfest zu machen. Im kommenden Jahr stehen fünf Landtagswahlen an, fast überall sind Stimmengewinne am linken und rechten Rand, vielleicht sogar Mehrheiten für radikale Parteien zu erwarten. Diese Parteien propagieren einfache Lösungen für die Probleme im Land. Damit diese Parolen nicht verfangen, müssen alle, die gesellschaftliche und politische Verantwortung tragen und diese ernst nehmen, eine gemeinsame Linie finden, um wieder stärker zu werden, damit die demokratische Mitte und die entsprechenden Werte erhalten bleiben. Dazu gehört, wie ich vorhin bereits ausgeführt habe, aber unbedingt politisches Handeln in der Art und Weise, wie es die Menschen einfordern und nicht lapidares Abbügeln von offenkundig begründeter Kritik. Von dieser Verantwortung nehme ich die ärztliche und die gemeinsame Selbstverwaltung natürlich nicht aus. Wir wollen nicht polarisieren und Gräben aufreißen, aber wir sollten uns auf unsere Stärke besinnen und auf unsere tragende Rolle für die gesellschaftliche Stabilität und damit den sozialen Frieden hierzulande. Und deshalb müssen wir uns auch einmischen.
Vielen Dank.
(Es gilt das gesprochene Wort.)