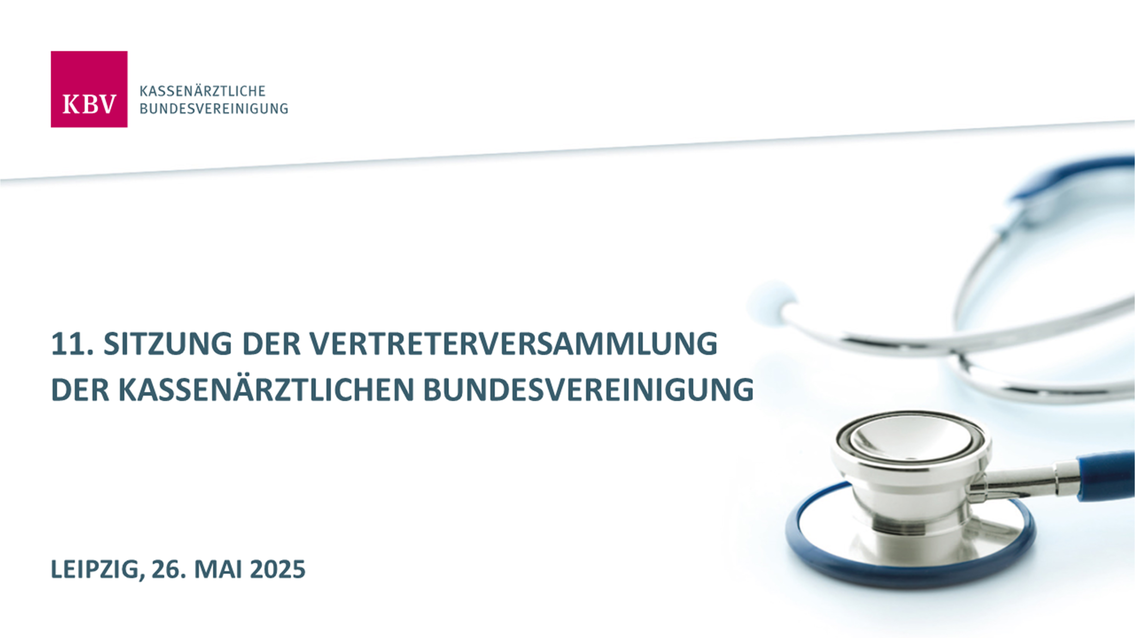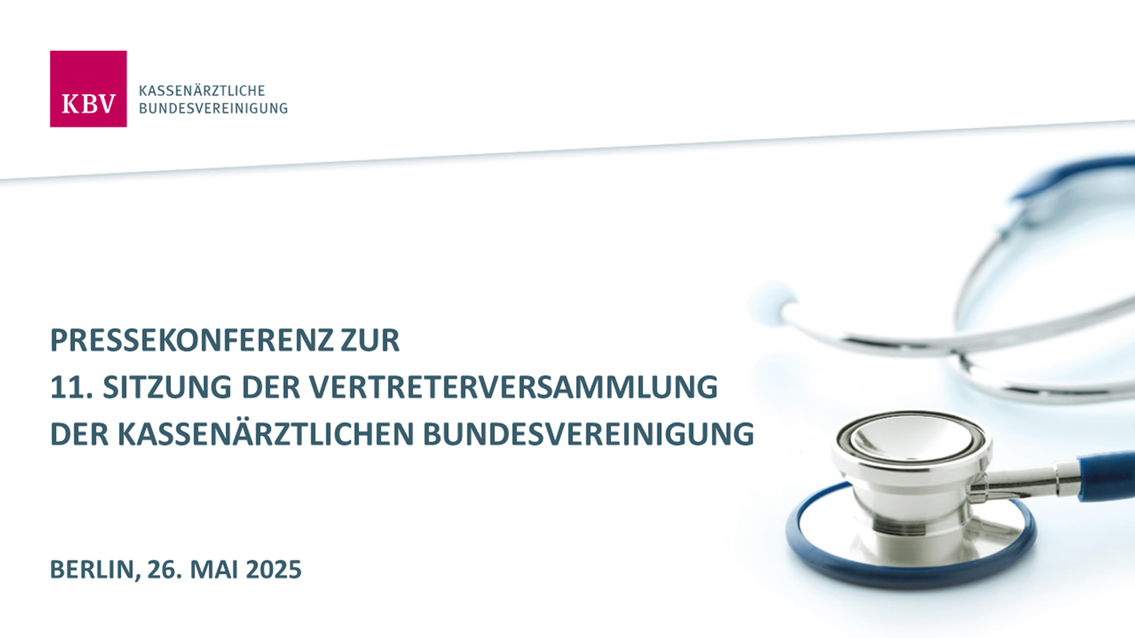Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,
ich begrüße Sie zur Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung hier in Leipzig.
Drei Wochen ist es her, dass die selbsternannte „Arbeitskoalition“ aus CDU, CSU und SPD die Regierungsgeschäfte aufgenommen hat. Der Start war mit der zunächst verstolperten Kanzlerwahl zwar etwas holprig, doch schlussendlich ist man in die Spur gekommen. Die Ministerien haben teilweise einen neuen Zuschnitt erhalten. Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) hat die neue Koalition unangetastet gelassen. Im Gegensatz zu einigen anderen Ressorts hat das BMG sogar die Zuständigkeit für Digitalisierung in seinem Bereich behalten. Ob das Fluch oder Segen ist, wird sich noch zeigen. Friedrich Merz hat jedenfalls einen arbeitsintensiven Herbst angekündigt und die parlamentarische Sommerpause verkürzt, wir haben nun im September drei Sitzungswochen.
Auch von dieser Stelle möchte ich unsere neue Bundesgesundheitsministerin noch einmal herzlich zu ihrer Ernennung beglückwünschen: Liebe Frau Warken, Sie haben in schwierigen Zeiten und bei knappen Kassen ein wichtiges Amt übernommen. Sehr gerne nehmen wir Ihr Angebot zum Dialog an, und freuen uns sehr, dass sie angekündigt haben, den Kontakt mit der Selbstverwaltung zu „suchen und zu pflegen“. Wir stehen für Gespräche bereit – wir hoffen aber auch, dass dies nicht Pseudo-Konsultationen sind, deren Ergebnisse bereits vorab feststehen, wie unter Frau Warkens Vorgänger. Wir vertrauen auf einen echten, offenen, aber auch kritischen Austausch.
Weder der Kanzler noch die neue Bundesgesundheitsministerin haben mit ihren ersten Reden für große Überraschungen gesorgt. In seiner ersten Regierungserklärung sprach der neue Bundeskanzler viel von Außenpolitik und von der Wirtschaft. Er versprach einen „beherzten Abbau der überbordenden Bürokratie“ und sagte, dass man „Unternehmen und ihren Beschäftigten nicht mit Misstrauen und Kontrollansprüchen begegnen" wolle, „sondern mit Vertrauen und eben mit Verantwortung“. Zu diesen von Ihnen erwähnten Unternehmen, lieber Herr Bundeskanzler, gehören auch die 99.000 Praxen im Land. Unser Praxenland zeichnet sich aus durch Selbstverantwortung mit Wirtschaftspower. So lautet sinngemäß auch einer der Slogans auf unseren neuen Kampagnenplakaten, die Sie sicher schon hier in Leipzig und andernorts gesehen haben. Also genau die beiden Eigenschaften, die Herr Merz anspricht. Denn die Wirtschaft, das sind eben nicht nur die Industrie und das produzierende Gewerbe. Auch unser ambulantes System, unsere Praxen, sind ein entscheidender Wirtschaftsmotor.
Die Praxen tragen 51,6 Milliarden Euro zur Bruttowertschöpfung bei. Das ambulante Gesundheitswesen, unser Praxenland, hat bei der Zahl der Beschäftigten mittlerweile die Automobilindustrie überholt. Vor allem aber trägt unser Praxenland dazu bei, dass Millionen Menschen in Deutschland möglichst gesund und damit leistungsfähig bleiben. Eine Reduktion der teils aberwitzigen Bürokratie sehnen die Praxen geradezu herbei, denn diese kostet jede von ihnen im Jahr sage und schreibe 61 Arbeitstage – 61 Tage, die ansonsten zur Patientenversorgung zur Verfügung ständen. Wenn Kanzler Merz in seiner Regierungserklärung betont, Deutschlands Sicherheit und Gestaltungskraft stehe und falle mit seiner wirtschaftlichen Stärke und damit mit dem Fleiß und der Leistung von Millionen Arbeitnehmern und Selbstständigen, dann kann ich nur feststellen: Eine gesunde Wirtschaft ist ohne gesunde Erwerbstätige nicht möglich. Um die von Herrn Merz beschworene Leistungsfähigkeit zu erhalten und Deutschland „wieder auf Wachstumskurs zu bringen“, braucht es eine hochwertige flächendeckende Gesundheitsversorgung, auf die sich die Menschen verlassen können.
Deshalb appelliere ich an die neue Bundesregierung: Lassen Sie uns gemeinsam an einem starken Gesundheitswesen und für den Erhalt unseres Praxenlandes arbeiten! Davon profitiert jede und jeder Einzelne – vor allem auch eine Wirtschaft in der Rezession.
Einige Weichenstellungen hat der Koalitionsvertrag von Union und SPD vorgenommen. Vieles ist jedoch noch vage. Und anders als noch im Ergebnispapier der Vorverhandlungen haben die Vertragspartner gerade die Finanzierungsfragen nahezu komplett ausgeklammert. Das verwundert schon. Eine Kommission soll’s richten, mit Zeit bis Anfang 2027. Wir erwarten, dass das KV-System an dieser Kommission beteiligt sein wird. Natürlich ist es richtig und zu begrüßen, dass man an einer nachhaltigen Lösung arbeiten und sich entsprechend Zeit dafür nehmen will. Denn die Flickschusterei mit immer nur punktuellen Zuschüssen und „Soforthilfen“ kann keine Dauerlösung sein, es bedarf eines langfristigen Konzepts zur Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Gleichwohl hat Ministerin Warken, die offenkundig über das Ausmaß der Finanzmisere bestürzt war, angekündigt, dass auch kurzfristige Maßnahmen „jenseits des Koalitionsvertrags“ erforderlich seien. Ein Bundeszuschuss in Höhe von 800 Millionen Euro an die Krankenkassen ist bereits erfolgt, doch dabei soll es nicht bleiben. Dem Vernehmen nach ist auch der Steuerzuschuss für Beiträge von Bürgergeldempfängern aus Frau Warkens Sicht immerhin diskussionswürdig. Das wäre allemal sinnvoller als das vom GKV-Spitzenverband – mit der gleichen Regelmäßigkeit wie der Murmeltiertag – geforderte sofortige Ausgabenmoratorium und weitgehende Verzicht auf Preis- und Honorarerhöhungen.
Zur Erinnerung: Der ambulante Bereich ist bereits quotiert und chronisch unterfinanziert. Gerade einmal 16 Prozent der GKV-Leistungsausgaben fließen in die vertragsärztlichen und vertragspsychotherapeutischen Praxen, obwohl diese 97 Prozent aller Behandlungsfälle versorgen. Im Gegenzug verursachen die Krankenhausbehandlungen ein Drittel der Ausgaben, versorgen aber nur drei Prozent der Fälle. Finde den Fehler.
Die GKV hat zweifelsohne Probleme, auch wenn man den Eindruck gewinnt, dass es immer wieder dieselben Krankenkassen sind, die Alarm geben. Möglicherweise sind diese Krankenkassen aus ganz anderen Gründen nicht wettbewerbsfähig. Da es keinen Mangel an Krankenkassen gibt, ist es vielleicht auch an der Zeit, den Anbietermarkt in der GKV zu bereinigen. Unternehmerische Fehler sind jedenfalls kein Grund, bei der Versorgung der Versicherten sparen zu wollen.
Natürlich gibt es Einsparpotenziale in der GKV. Und es gibt erhebliche finanzielle Belastungen durch Kostenblöcke, die nicht durch die Versichertengemeinschaft zu finanzieren sind. Würde man die Krankenkassen beispielsweise konsequent von versicherungsfremden Leistungen entlasten – etwa bei den Beiträgen für Bürgergeldbeziehende, bei Investitionskosten für Krankenhäuser oder bei der Digitalisierung –, könnte man mehr Geld einsparen, als die Kassen für die gesamte vertragsärztliche Versorgung ausgeben. Und da rede ich noch gar nicht von weiteren kostensenkenden Maßnahmen wie einer konsequenten Ambulantisierung, von der im neuen Koalitionsvertrag keine Rede mehr ist.
Schauen wir doch einmal hinein in den Koalitionsvertrag: Da stehen neben typischen Allgemeinplätzen durchaus einige konkrete oder konkret scheinende Dinge drin. Die Bundesregierung will zum Beispiel eine Bagatellgrenze einführen – das ist richtig, wichtig und lange überfällig. Die Bundesregierung will natürlich Versorgung verbessern und Praxen entlasten – was auch sonst. Das soll unter anderem mit einem verpflichtenden Primärarztsystem bei freier Arztwahl geschehen. Hier könnte man schon belustigt die Augenbraue hochziehen und auf Unvereinbarkeiten von „verpflichtend“ und „frei“ hinweisen, man könnte süffisant anmerken, wo denn die Primärärzte herkommen sollen, die man dafür bräuchte. Aber damit würde man dem Koalitionsvertrag Unrecht tun. Denn im Folgenden wird weiter ausgeführt und das Primärarztsystem wird um einige Facetten durchaus sinnvoll erweitert, mit denen man das Ganze sogar umsetzen könnte. Hier trifft es sich gut, dass wir als KV-System uns bereits unsere Gedanken zur besseren Steuerung und Koordinierung gemacht haben.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema Steuerung wird ein politisches Kernthema für die neue Legislatur. Das Ziel eines wie auch immer gearteten Primärarztsystems mit einer verbindlichen Koordinierung und besseren Steuerung der Versorgung ist gesetzt. Auch wenn der Koalitionsvertrag das anders suggeriert: Natürlich handelt es sich damit um eine Beschränkung der freien Arztwahl, das liegt in der Natur der Sache; und das Ganze kann auch nur dann die beabsichtigte Wirkung entfalten, wenn die Patienten sich an die Vorgaben halten müssen. Das gilt auch heute schon für die hausarztzentrierte Versorgung, wird dort nur nicht konsequent gelebt, weshalb jeder fünfte Patient parallel auch noch im Kollektivvertrag hausärztlich behandelt wird.
Vielleicht wird dem einen oder anderen von Ihnen jetzt unbehaglich. Es wurde ja in jüngster Zeit sinngemäß behauptet, das KV-System habe keine Ahnung von primär- oder gar hausärztlicher Steuerung und der Kollektivvertrag sei sowieso nicht geeignet für eine erfolgreiche Umsetzung dieses Vorhabens. Die Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) und die Ärztinnen und Ärzte im Kollektivvertrag wurden in diesem Zusammenhang als „Nichtschwimmer“ tituliert, die man damit plötzlich ins Becken schubse.
Deshalb haben wir da etwas vorbereitet und ich bitte unsere Mitarbeitenden, das jetzt im Saal zu verteilen … [Im Saal werden kleine Schwimmringe ausgeteilt]… Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen: Wir sind bestens gewappnet! Es kann nichts mehr schiefgehen.
Aber Spaß beiseite. Noch einmal zur Erinnerung: Vertragsärztinnen und -ärzte sowie Vertragspsychotherapeuten und -psychotherapeutinnen im Kollektivvertrag sind das Versorgungsversprechen für 73 Millionen Versicherte, mit 575 Millionen Behandlungsfällen jedes Jahr und über eine Milliarde Patientenkontakte.
Das KV-System, dass mit seinen 99.000 haus- und fachärztlichen sowie psychotherapeutischen Praxen die Versorgung für 73 Millionen GKV-Versicherte von den Nordseeinseln bis zum Werdenfelsener Land sicherstellt, das Not- und Bereitschaftsdienst organisiert, Weiterbildung finanziert, die 116117 betreibt, Qualitätssicherung organisiert, junge Kolleginnen und Kollegen bei der Niederlassung unterstützt und so weiter, und so weiter. Und dieses System soll Steuerung und Koordination nicht organisieren können?
Natürlich ist Steuerung und Koordination mehr als das Ausstellen einer bloßen Überweisung. Wer seinen Beruf als Hausärztin oder Hausarzt oder auch als fachärztlicher Kollege ernst nimmt, der weiß das und tut das bereits. Ich hoffe sehr, dass niemand den Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag danach handeln, etwas anderes unterstellt. Insofern findet vieles von dem, was der Koalitionsvertrag fordert, bereits millionenfach in unseren Praxen statt. Das werden wir sichtbar machen und auch attraktiv.
Wir haben als KV-System ein konkretes Konzept, wie die ambulante Patientensteuerung in der Notfall-, Akut- und in der Regelversorgung aussehen kann. Die Vorschläge zur bedarfsgerechten Steuerung in der Notfall- und Akutversorgung haben wir bereits auf der Vertreterversammlung im März mit Ihnen abgestimmt. Dort haben Sie uns als KBV-Vorstand den Auftrag erteilt, außerdem Konzepte für Koordinierungsmodelle in der ambulanten Regelversorgung mit einer bedarfsgerechten Finanzierung zur internen Beratung vorzulegen. Die entsprechenden Vorschläge haben wir auf der Klausursitzung der Vertreterversammlung Anfang Mai intensiv und konstruktiv diskutiert. Wir kamen zu einer gemeinsamen Lösung, wofür ich mich an dieser Stelle noch einmal bedanke. Alle unsere Diskussionen sind nun in ein gemeinsames Papier geflossen, das wir Ihnen heute zur Beschlussfassung vorlegen. Da nur der Teil zur Regelversorgung neu ist, möchte ich es an dieser Stelle bei einer kurzen Zusammenfassung dieses Themas belassen.
Unsere Vorschläge lauten wie folgt:
- Als Primärärzte fungieren Hausärztinnen und Hausärzte (das heißt Allgemeinmediziner beziehungsweise hausärztlich tätige Internisten), Fachärztinnen und Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin oder Fachärztinnen und Fachärzte für Gynäkologie und Geburtshilfe.
- Patienten, die beispielsweise unter einer schweren chronischen Erkrankung leiden, muss der Direktzugang zu einem fachärztlichen Bezugsarzt ohne Überweisung ermöglicht werden.
- Ebenfalls ohne Überweisung können Fachärztinnen und Fachärzte für Augenheilkunde sowie ärztliche und psychologische Psychotherapeuten aufgesucht werden.
- Für reine Früherkennungsuntersuchungen und Schutzimpfungen ist ebenfalls keine Überweisung erforderlich.
- Die steuernden Ärztinnen und Ärzte fungieren als Koordinatoren im gesamten Behandlungsprozess. Für entsprechende Aufgaben wie zum Beispiel Terminvermittlung, Behandlungsplanung und Nutzung von Telemedizin sind entsprechende Gebührenordnungspositionen in den Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) aufzunehmen. Dabei sind Leistungen, die über bereits im EBM bestehende Inhalte hinausgehen, von den Krankenkassen zusätzlich zu finanzieren.
Natürlich benötigen nicht alle Patienten eine primärärztliche Steuerung. Der ansonsten gesunde junge Mensch, der sich am Wochenende auf dem Sportplatz den Fuß verknackst, hat häufig gar keinen Hausarzt und benötigt auch keinen regelmäßigen ärztlichen Ansprechpartner. Hier kann die 116117 eine sinnvolle Alternative sein. Dort kann – nach einer strukturierten medizinischen Ersteinschätzung – ein fachärztliches Terminangebot mit einer Termingarantie unterbreitet werden. Dies kann dann allerdings keine Wunschpraxis des Patienten sein. Alternativ kann der Patient oder die Patientin sich mit der durch die 116117 erfolgten fachärztlichen Zuweisung, also gewissermaßen einem entsprechenden Ticket, selbst an eine Praxis der Wahl wenden und dort einen Termin vereinbaren. In diesem Fall hat er oder sie jedoch keinen Anspruch auf eine zeitliche Termingarantie.
Damit die 116117 ausreichend Termine anbieten kann, müssen Praxen diese entsprechend zur Verfügung stellen. Für sämtliche über die Plattform vermittelten Termine brauchen die Praxen eine Vorhaltefinanzierung, damit ihnen bei Nichtvergabe beziehungsweise bei Nichterscheinen des Patienten keine finanziellen Nachteile entstehen. Denn gerade Facharztpraxen mit entsprechenden Untersuchungen können einen ausgefallenen Termin oft nicht einfach ersetzen. Sämtliche Leistungen, die fachärztliche Kollegen auf Basis einer qualifizierten Überweisung oder einer Vermittlung durch die 116117 erbringen oder veranlassen, sind extrabudgetär zu vergüten.
Niemand wird aber glauben, dass es nicht auch Versicherte geben wird, die Fachärztinnen und -ärzte ihrer Wahl direkt und ungesteuert aufsuchen. In diesen Fällen sollte der Versicherte sich jedoch an den Kosten beteiligen. Die Ausgestaltung und Abrechnung einer solchen Eigenbeteiligung hat die jeweilige Krankenkasse zu regeln.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, dass wir mit diesen Vorschlägen ein schlüssiges und gangbares Konzept vorlegen, wie ein primärärztliches System gelingen kann, ergänzt durch die 116117 als Vermittlungsplattform und auch dem Umstand Rechnung tragend, dass einige Patienten sich nicht steuern lassen möchten. Gleichzeitig vermitteln wir die klare Botschaft, dass es mehr Rationalität und Verbindlichkeit für alle bedarf, wenn das System auch künftig gut für alle funktionieren soll. Dieser Teil des Koalitionsvertrages kann also durchaus gelingen.
Was für unser KV-System aber nicht funktionieren wird, ist die skurrile Idee, in einem budgetierten System auch noch Geld umzuverteilen, indem Abschläge von der Vergütung in überversorgten und Zuschläge in unter- oder drohend unterversorgten Gebieten eingeführt werden sollen. Die Entbudgetierung von Fachärztinnen und Fachärzten in unterversorgten Gebieten will man hingegen nur noch „prüfen“. Vielleicht hätte man hier besser jemanden gefragt, der weiß, wie die Realität aussieht.
Tatsächlich gibt es nur in drei von 21 Gebietsfachgruppen eine Unterversorgung laut Bedarfsplanung (50 Prozent Versorgungsgrad), nämlich bei Augen-, HNO- und Hautärzten. Eine drohende Unterversorgung (75 Prozent Versorgungsgrad) wurde bei sechs weiteren Fachgruppen festgestellt. Schaut man auf die Regionen, so sind von bundesweit 3.773 fachärztlichen Planungsregionen 17 unterversorgt und 64 drohend unterversorgt. Das sind insgesamt 2,1 Prozent. „Gefühlt“, und teilweise auch tatsächlich, stellt sich die Situation an manchen Orten natürlich anders dar. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Als „Fairnessausgleich“, wie im Koalitionsvertrag bezeichnet, taugen solche Maßnahmen jedenfalls kaum und wären überdies nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Ähnlich realitätsfern mutet die sogenannte Termingarantie für Facharzttermine an. Genauso die politische Zusage, alternativ eine fachärztliche Behandlung im Krankenhaus in Anspruch nehmen zu können. Denn gerade diejenigen Fachrichtungen, bei denen Termine begehrt sind, wie Dermatologie, Augenheilkunde et cetera, halten die Krankenhäuser in der Fläche oft gar nicht mehr vor. Umso weniger verständlich ist es, dass die Politik beim Thema Weiterbildung nur auf die Haus- und Kinderärzte schaut, statt die ambulante Weiterbildung auch in anderen Fachgebieten verstärkt zu fördern, obwohl wir als KV-System hierfür ein Konzept vorgelegt haben.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit komme ich zum Schluss und noch einmal zurück auf die eingangs zitierte Regierungserklärung von Friedrich Merz. In seiner Rede sagte der Bundeskanzler auch, an das Bundestagsplenum gewandt: „Als Demokraten der politischen Mitte eint uns: Wir sind dem Gemeinwohl verpflichtet.“ Um es klar zu sagen: Das gilt auch für uns als KBV und KVen! Angesichts sich verändernder Rahmenbedingungen, der politischen Landschaft im Allgemeinen und der Herausforderungen für das Gesundheitswesen im Besonderen, wollen wir als KBV unser Leitbild anpassen. Darin betonen wir, dass Grundlage unseres Handelns der Anspruch an unser Gesundheitssystem ist, allen Menschen unabhängig von Herkunft, Religion, Geschlecht oder sozialem Status eine hochwertige ambulante Versorgung zu garantieren. Des Weiteren sehen wir uns dazu veranlasst, die Bedeutung der freien Berufsausübung für Ärzte und Psychotherapeuten zu ergänzen sowie den unabdingbaren Schutz und die Vertraulichkeit der professionellen Beziehung zu den Patienten, auch und gerade im Zeitalter der Digitalisierung. Ergänzt haben wir außerdem unsere angestrebte enge Zusammenarbeit mit den Partnern der Selbstverwaltung sowie die klare Ablehnung staatlicher Eingriffe in die Selbstverwaltung. In unserem Verhältnis zu den KVen begreifen wir uns als Wissensorganisation und strategischer Sparringspartner.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Koalitionsvertrag trägt die Überschrift „Verantwortung für Deutschland“. Als KBV und KVen sind wir dem Gemeinwohl verpflichtet. Diese Verantwortung tragen wir durch unseren gesetzlichen Auftrag und aus eigenem Anspruch auf Basis unserer Werte, die uns – auch bei möglichen Auseinandersetzungen in der einen oder anderen Sachfrage – auch weiterhin leiten sollten.
Vielen Dank!
(Es gilt das gesprochene Wort)